Bericht verfasst von Dr. A. Unger, Donauwörth, Fachjournalist und Autor des FUSSBODEN ATLAS®
Der Beitrag beinhaltet teils wörtliche Zitate aus den einzelnen Skripten.
Die Veranstalter entschieden sich, das 8. FUSSBODEN-FORUM® in der Weitblick Eventlocation in München anzubieten. Ca. 100 Besucher kamen zu dem Event. Die Moderation übernahm wieder Dr. A. Unger als Hauptveranstalter für die Unger Firmengruppe.
1) Abdichtungssysteme und barrierefreie Übergänge bei Terrassen und Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531
Referent: Dipl.-Ing. Uwe Haubitz, BMI Flachdachsysteme GmbH
Der Referent erläuterte die aktuell gültigen Normen und Fachregeln für die Ausführung von Bauwerksabdichtungen in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen. Die Strukturen der Abdichtungsnormen erleichtern dem Planer eine zielorientierte fachlich korrekte Planung der jeweiligen Abdichtungsmaßnahme.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen hochwertigen Abdichtungsmaßnahmen bei Terrassen gegenüber auch einfacheren Lösungen bei Balkonen, Loggien und Laubengängen wurde aufgezeigt.
Grundsätzlich wird empfohlen, immer bei diesen Abdichtungsmaßnahmen den Lebenszyklus des Abdichtungssystem mit zu berücksichtigen. Die Materialkosten der Abdichtung betragen bei diesen Abdichtungsflächen ein Minimum gegenüber den Gesamtkosten der Abdichtungsmaßnahme. Somit sollte immer auf hochwertige Abdichtungsprodukte mit Langzeiterfahrung zurückgegriffen werden.
Hinzu kommt, dass diese Produkte bei der Vielzahl von Detailausbildungen bei diesen Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. Ecken, Türanschlüsse, Laibungen, einfach und dauerhaft sicher ausgeführt werden können. Hier haben sich hochwertige Kunststoffdachabdichtungsbahnen in den letzten Jahrzehnten bewährt.
Insbesondere der Anspruch von barrierefreien Übergängen bei der Abdichtung von Terrassen, Balkonen, Loggien und Laubengängen stellt eine besondere Herausforderung an den Planer dar.
Barrierefreie Übergänge sind Sonderkonstruktionen. Sonderkonstruktionen sind Konstruktionen die nicht normativ geregelt sind. Sie erfordern, so die Fachregeln, abdichtungstechnische Sonderlösungen die zwischen Planer und Türhersteller sowie ggf. dem Ausführenden der Abdichtungsmaßnahme abzustimmen sind. Diese planerischen Maßnahmen sind objektbezogen zu treffen und gesondert zu vereinbaren. Eine systemgerechte Sonderlösung mit einem ausgeklügelten System eines Türherstellers und einer Kunststoffdachabdichtungsbahn hat sich bereits in der Praxis bewährt.
Abschließend verwies der Referent Dipl.-Ing. Uwe Haubitz auf verschiedene Hilfen für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit barrierefreien Übergängen bei Terrassen, Balkonen, Loggien und Laubengängen.

Quelle: BMI WOLFIN
2) ‘we care – we act‘
Der Wertekompass für nachhaltige Bauprodukte
Referentin: Stefanie Jutkeit, Gerflor Mipolam GmbH
Frau Jutkeit gab in ihrem Vortrag einen Überblick darüber, wie sich Gerflor, als Hersteller für elastische Bodenbeläge, den Themen der Nachhaltigkeit nähert. Denn auch in der Baubranche wird es immer wichtiger, auf nachhaltige Lösungen zu setzen. Neben dem Schutz des Klimas und unserer Umwelt steigen auch die regulatorischen Anforderungen der EU und des Gesetzgebers. In diesem Ozean der Themen brauchen wir gute Kompasse, um navigieren zu können. Drei davon stellte Frau Jutkeit vor:
Als erstes bietet der jährlich erscheinende CSR-Report einen guten Überblick darüber, wo das Unternehmen insgesamt steht. Bei Gerflor zeigt er, wie die fünf selbst gesteckten Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie „we care / we act“ erreicht werden sollen und was bereits erreicht wurde. Bis 2025 möchte Gerflor seinen CO2-Fußabdruck um 20 % verringern, den Anteil natürlicher Rohstoffe in seinen Bodenbelägen verdoppeln, mehr Produkte für die klebstofffreie Verlegung anbieten und sowohl den Anteil an Recyclingmaterial im Bodenbelag als auch das Recyclingvolumen des aktiv zurück geholten Materials erhöhen. Letzteres geschieht über das Rücknahme-Programm „Second Life“, bei dem Bodenleger ihre Verschnittreste sammeln und von Gerflor abholen lassen können. Diese werden dann in den unternehmenseigenen Recyclingcentern an den jeweiligen Produktionsstandorten aufbereitet, um direkt wieder in die Produktion einzufließen. 2025 werden so voraussichtlich ca. 60.000 Tonnen Recyclingmaterial zurückgewonnen und zu neuen Produkten verarbeitet.
Als zweiten Kompass stellte Frau Jutkeit den, gemeinsam mit dem TFI (einem unabhängigen Prüfinstitut in Aachen) entwickelten Produktpass Nachhaltigkeit vor. Auf wenigen Seiten zeigt dieser klar und übersichtlich, was der jeweilige Bodenbelag zu einer bestimmte Gebäudezertifizierung wie z.B. LEED, BREEAM oder DGNB beitragen kann. Der Produktpass Nachhaltigkeit schließt eine Kommunikationslücke zwischen Hersteller und Planer bzw. Bauherr und gibt eine Orientierung darüber, was Produkte leisten – transparent und durch ein externes Institut verifiziert.
Zuletzt ging Frau Jutkeit auf das Environmental Datasheet ein, mit dem jedes Produkt von Gerflor sukzessiv ausgestattet wird. Hier werden z.B. Daten über den CO2-Fussabdruck transparent und unkompliziert aufbereitet. Unter anderem auf der Internetseite ist es direkt beim Produkt für jeden verfügbar. Eine Hilfe besonders für Planer, die eine Ökobilanz für Gebäude erstellen möchten.
Diese drei Kompasse helfen Gerflor auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, aber deutlich wurde auch: Nachhaltigkeit geht nur zusammen. Kooperation und Austausch sind wesentlich für wirklich sinnhafte Lösungen.
3) Richtige Verlegung zur Vermeidung von Schäden bei großformatigen Fliesen
Referent: Alexander Buck, codex GmbH & Co. KG
Der Referent Herr Buck befasste sich mit dem Thema ‚Großformatige Fliesen bzw. Megaformate‘.
Zunächst erörterte er, warum die großformatigen Fliesen voll im Trend liegen und stellte die Menge der Vorteile dar. Weiters zeigte er auch Möglichkeiten auf, wie weitere Aufträge durch z.B. Verkleidung eines Kamins oder Bau von Waschbecken generiert werden können. Im nächsten Punkt kamen die zurzeit gültigen Vorschriften und Normen zur Sprache, um auch zu definieren, was überhaupt Groß,- bzw. Megaformate sind.
Herr Buck wies aber auch darauf hin, das großformatige Fliesen einen erhöhten Planungsaufwand erfordern, sowie die Auswahl der richtigen Bauchemie sehr wichtig ist.
Denn die Norm „DIN 18202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau“ reicht nicht immer für die benötigte Ebenheit des Untergrunds aus. Außerdem erfordern feuchteempfindliche Untergründe besondere Maßnahmen. Hierzu zeigte er unterschiedliche Lösungen auf.
Als Zusammenfassung kann festgestellt werden: Großformatige Fliesen fordern eine erhöhten Planungsaufwand sowie stellen Anforderungen an die Wahl der richtigen Bauchemie. Allerdings kann es als Chance genutzt werden, um zusätzliche Aufträge zu generieren.
4) Aktuelle Rechtsprechung und wichtige Urteile für Architekten und Bauleiter
Referent: Syndikus-RA Hilmar Toppe, Bauinnung München
Zunächst erläuterte Rechtsanwalt Toppe einen Fall, bei dem es um eine Mehrvergütung des Planers wegen Bauzeitverlängerung ging. Die vertraglich vorgesehene Bauzeit belief sich auf drei Jahre und es war geregelt, dass eine Bauzeitüberschreitung von 20% bereits durch das Honorar abgegolten sei. Ansonsten sollte nur ein Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens bestehen. Insgesamt belief sich dann die Bauzeit auf fünf Jahre und der Planer verlangte 305.000,00 Euro mehr für seinen zusätzlichen Aufwand. Da sich die Bauzeit um 41% verlängert hatte, ging er auch von einem erhöhten Arbeitsaufwand in Höhe von 41% aus. Das entscheidende Gericht kam zu dem Schluss, dass kein Mehrvergütungsanspruch entstanden sei. Der Planer hätte darlegen müssen, ob und welche konkrete Pflichtverletzung oder Behinderung es seitens des Auftraggebers gab, zu welchen konkreten Verzögerungen diese führten und welcher Mehraufwand damit für ihn verbunden war. Fiktive Kosten und Hochrechnungen reichen nicht zur Begründung. Insofern ist für jede einzelne Behinderung gesondert festzuhalten, welche Auswirkungen diese auf den Bauablauf haben. Diese sind genau zu dokumentieren.
In einem anderen Fall ging es um einen Schadensersatzanspruch wegen einer Baukostenüberschreitung. Es sollte ein Wasserturm zu einem Wohngebäude umgebaut werden und das vorgesehene Budget lag bei 1,2 Millionen Euro. Es gab keine klare Vereinbarung zur Baukostenobergrenze und der Planer wies auf höhere Baukosten hin. Seitens des Auftraggebers gab es jedoch keine Bereitschaft für Einsparungen und im Nachhinein verlangte er trotzdem Schadensersatz wegen den erhöhten Baukosten. Das entscheidende Gericht kam zu dem Schluss, dass es an einem erstattungsfähigen Schaden fehlte, da der Auftraggeber trotz Hinweis auf die höheren Kosten nicht zu wesentlichen Kosteneinsparungen bereit war.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Berufshaftpflichtversicherung der Architekten und Ingenieure Schäden aus Überschreitung von Kostenschätzungen und Kostenberechnungen i.d.R. nicht übernimmt.
Als nächstes ging es um eine Sicherheitsleistung nach § 650 f BGB bei einem gekündigten Bau- bzw. Planervertrag. Es wurden Bauleistungen beauftragt und es gab ein Sicherungsverlangen in Höhe von ca. 5 Millionen Euro unter Fristsetzung. Darauf reagierte der Auftraggeber mit fristbewährten Mängelrügen. Der Auftragnehmer stellte daraufhin die Arbeiten ein und klagte auf eine Sicherheit in Höhe von 2 Millionen Euro. Daraufhin kam es zu einer Kündigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber. Der BGH gewährte die Sicherheit in Höhe von knapp 1.100.000,00 Euro aufgrund der schlüssigen Darstellung des Auftragnehmers. Entgegen der Vorinstanz hielt er eine Schätzung der Höhe der zu stellenden Sicherheit für nicht erforderlich.
RA Toppe machte darauf aufmerksam, dass auch Planer die Sicherheit nach § 650f BGB verlangen dürfen. Allein öffentlichen Auftraggebern sei die Sicherheit nicht zu stellen, da § 650f BGB gegenüber diesen nicht anwendbar ist.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit der Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypothek nach § 650 e BGB. Dies geht jedoch nur, wenn der Auftraggeber Eigentümer des Baugrundstücks ist. In dem vorgestellten Fall erbat ein Planer die entsprechende Sicherheit, die der Auftraggeber nicht zur Verfügung stellen wollte. Daraufhin beantragte der Planer den Erlass einer Vormerkung zur Absicherung einer Bauhandwerkersicherungshypothek. Das letztendlich entscheidende Gericht kam zu dem Schluss, dass der Planer Anspruch auf die Vormerkung hatte. Es gab keinen Grund, den Planer schlechter als einen Bauausführenden zu stellen, auch wenn seine Planungsleistung noch nicht in einem Bauwerk umgesetzt worden war.
Schließlich ging es um das Widerrufsrecht von Verbrauchern. Im besprochenen Fall bot ein Planer einem Verbraucher, der ihn persönlich bereits kannte, Leistungen in einer E-Mail an. Am folgenden Tag wurde er beauftragt. Nachdem der Planer seine Leistungen erbracht hatte und der Verbraucher diese auch zahlte, widerrief der Verbraucher den Vertrag binnen eines Jahrs und 14 Tagen und verlangte die geleistete Zahlung zurück. Der BGH kam zu dem Urteil, dass kein Widerrufsrecht bestand. Weder würde ein Fernabsatz- noch ein außerhalb der Geschäftsräume abgeschlossener Vertrag vorliegen, der Voraussetzung für ein gesetzliches Widerrufsrecht sei. Rechtsanwalt Toppe wies darauf hin, dass es in dem vom BGH entschiedenen Fall um einen Bauvertrag ging. Gleichwohl seien die vom BGH genannten Grundsätze auch für Planerverträge anwendbar.
5) Gewerbe- und Industrieböden aus Reaktionsharzen: funktional, robust und wirtschaftlich
Referent: Dipl.-Ing. Artur Kehrle, KLB Kötztal
Moderne Beschichtungen aus 2-Komponenten-Reaktionsharzen machen vieles möglich. Heute werden Beschichtungen nicht nur in Industrieobjekten als wirtschaftlicher und robuster Bodenbelag eingesetzt, sondern auch in Bereichen mit hohen ästhetischen Anforderungen in gewerblichen Bereichen, öffentlichen Bauten und vieles andere mehr.
Betonplatten mit hochwertigem, geglättetem Beton haben in vielen Bereichen, wie z.B. in Lagern, Speditionen, Kommissionsbereichen durch die Belastung mit Flurfördergeräten und Warenumschlag eine hohe mechanische Belastung und sind in diesen Bereichen hervorragend geeignet.
Werden jedoch noch weitere Eigenschaften gefordert, so reichen Industriebetonflächen oft nicht aus. Betonflächen zeigen Schwächen bei Reinigung und Hygiene, chemischer Beständigkeit, haben keine Schutzfunktionen vor eindringenden Stoffen, weisen Krakeleerisse auf und natürlich ist Beton im Laufe der Nutzung nicht sonderlich dekorativ. Beschichtungen können in diesen Bereichen deutlich bessere Ergebnisse liefern, insbesondere dann, wenn eine Sanierung ansteht.
Wichtig für die Planung ist, dass die Anforderungen der geplanten Nutzung im Objekt, wie mechanische, chemische und thermische Belastungen bekannt sind und der Belag sowie die Materialauswahl gut abgestimmt werden.
Reaktionsharz-Beläge haben ein breites Eigenschaftsprofil und können in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die Beschichtungen sind fugenlos verlegbar und eignen sich auf alten und neuen Untergründen. Aufgrund der großen Flächenleistung bei der Verlegung ist der Einbau wirtschaftlich. Durch abgestimmte Verlegematerialien können die Stillstandzeiten kurzgehalten werden. Hinzu kommen geringe Schichtdicken von 1 bis 10 mm, was insbesondere in der Sanierung, zum Beispiel auf Altbelägen, sinnvoll und hilfreich ist.
Reaktionsharz-Beschichtungen weisen eine Vielzahl von positiven Eigenschaften auf. Es können inzwischen auch strukturierte Oberflächen mit entsprechender Rutschhemmung oder abriebfeste, stoß- und schlagfeste Beschichtungen ausgeführt werden. Die Ausführung kann chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig sowie auch beim Einsatz von Heißwasser erfolgen. Dabei spannt sich der Bogen von der Chemie-, Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie. Elastische Beschichtungen, die rissüberbrückend und kälteflexibel sind, eignen sich besonders zum Schutz von Baukörpern und Grundwasser, in Bereichen, wie Parkhäusern und der Abdichtung von Bauwerken.
Neben der Industrie werden auch immer mehr gewerbliche und auch private Objekte mit Beschichtungen ausgeführt. Dabei kommt es mehr auf den dekorativen Aspekt von Beschichtungen an. Durch eine Vielzahl neuer Werkstoffe, die in den letzten 20 Jahren auf den Markt gekommen sind, können Beschichtungen äußerst dekorativ, mit großer Farbvielfalt, Struktur und anderen Effekten ausgeführt werden. Dabei nimmt die fugenlose Optik sicher eine wichtige Rolle ein. Sogenannte „Betonlookoptiken“, Wischtechniken oder auch der Wunsch nach sehr hellen Fußböden liegen im Trend. Dabei ist zu berücksichtigen, dass solche Beläge nicht in den industriellen Bereichen einzusetzen sind.
Werden beanspruchbare Beschichtungen gefordert, werden diese als Beläge mit Colorsand, sowohl in Abstreutechnik als auch in Mörteltechnik, ausgeführt.
Reaktionsharz-Beläge haben eine wichtige Bedeutung in der Sanierung von Fußböden. Zum einen aufgrund der sehr schnellen Ausführung, die in der Industrie auch während des laufenden Betriebes erfolgen kann. Alte Reaktionsharz-Beschichtungen, soweit diese festhaftend sind, können überbeschichtet werden. Somit wird Zeit, Aufwand und Material eingespart. Beschichtungen eignen sich auf verschiedenen Untergründen, wenn die angepassten Materialien dazu eingesetzt werden. So können neben Beton, Zementestrich, Magnesia-, Gussasphaltestriche, aber auch eine Vielzahl anderer Untergründe beschichtet werden.
Reaktionsharz-Beschichtungen können eine Vielzahl bautechnischer Anforderungen erfüllen. Dazu zählen die Anforderungen an Oberflächenschutzsysteme, Rutschhemmung, Brandschutz u.a.m. Bedeutungsvoll ist auch, dass Beschichtungen in Aufenthaltsräumen eingesetzt werden können. Die meisten Beschichtungssysteme können in emissionsarmen, zertifizierten Systemen ausgeführt werden.
Beschichtungen können somit äußerst variabel in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und stellen oftmals eine interessante Alternative dar.
6) ‘Warm, weich, leise‘. Komfort, Wohlbefinden und akustisch wirksam: Teppichfliesen
Referent: Jürgen Otto, Milliken Europe BV
Im Zeitalter des modernen Bürodesigns, in dem sitzende Tätigkeiten vorherrschen, ist die Bedeutung eines komfortablen und nachhaltigen Arbeitsumfeldes nicht zu unterschätzen.
Der US-amerikanische Teppichfliesen-Hersteller Milliken setzt Standards für das Bodenbelagsdesign in modernen Arbeits- bzw. Büroumgebungen.
Die Teppichfliesen sind nicht nur warm, weich und leise; sie sind ein Zeugnis für das Engagement eines Unternehmens, das Wohlbefinden der Menschen in Büros zu verbessern. Der einzigartige Polsterrücken, hergestellt aus recycelten Materialien, steigert signifikant den Komfort beim Gehen und Stehen. Diese Innovation verbessert nicht nur die Ergonomie, sondern trägt auch zur Langlebigkeit der Produkte und zum Umwelt- und Klimaschutz bei.
Im Geiste des biophilen Designs, das seine Inspiration aus der Liebe zur Natur zieht, integrieren diese Teppichfliesen natürliche Farben und Materialien, die positiv zur Atmosphäre und Akustik im Büro beitragen. Die spezialisierten Produktangebote des Unternehmens und ein engagiertes Team von Designerinnen und Designern arbeiten eng mit Kundinnen und Kunden weltweit zusammen, um das Wohlbefinden in Büroumgebungen mit durchdachtem Design zu fördern.
Millikens TractionBack-Innovation ermöglicht eine klebstofffreie Verlegung, reduziert die Präsenz flüchtiger organischer Verbindungen und vereinfacht die Wartung. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens, die im Nachhaltigkeitsprogramm M/PACT deutlich wird: Dieses stellt sicher, dass alle Produkte kohlenstoffneutral sind. Der Einsatz von Hochleistungsfasern und recycelten Materialien sowie erneuerbarer Energie in der Produktion sind wesentliche Bestandteile der Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Vielseitigkeit von Teppichfliesen bietet sehr viele Möglichkeiten im Bodenbelagsdesign und unterstützt die moderne Innenarchitektur in Büros durch Zonierungskonzepte, nahtlose Optik und individuelle Farbschemata, die, wenn gewünscht, auch die Unternehmensidentität bzw. den visuellen Markenauftritt widerspiegeln können.
Die patentierte Digitaldrucktechnologie Millitron® ermöglicht ein personalisiertes Design, ohne bei Nachhaltigkeit oder Leistung Kompromisse einzugehen.
Darüber hinaus sind die akustischen Eigenschaften dieser modularen Bodenbeläge bemerkenswert. Der Aufbau der Fliesen zusammen mit dem Polsterrücken kann den Trittschall um bis zu 50% reduzieren, ein bedeutender Faktor zur Steigerung der Produktivität der Belegschaft durch Minderung von Lärm in Arbeitsumgebungen.
Zusammenfassend setzt das Unternehmen mit seinem innovativen Ansatz im Bodenbelagsdesign für Büro- und Arbeitsumgebungen neue Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Nachhaltigkeit und ästhetische Flexibilität. Während das Unternehmen die Prinzipien von „reduce, reuse, recycle“ weiter erforscht, steht es an der Spitze der Schaffung von Büroumgebungen, die nicht nur funktional und schön, sondern auch verantwortungsbewusst und nachhaltig sind.
7) Neues zu Schnellzementen und Beschleunigern
Referent: Uwe Kunzelmann, Uzin Utz SE
Einleitend wurde ein Fallbeispiel einer aktuellen Baustelle angesprochen. Es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beteiligten Architekt, Bauherr, Estrichleger und dem Bodenleger bezüglich der Trocknung und Belegreife des eingebrachten Zementestrichs. Obwohl ein Schnellestrich ausgeschrieben wurde, war der Feuchtegrenzwert des Bodenlegers zu hoch für die Verlegung des Vinylbodens. Die Baustelle war in Verzug.
Nachfolgend erklärte Hr. Kunzelmann, dass sich unter dem irreführenden Sammelbegriff ‚Schnellestrich‘ zwei grundverschiedene Estricharten verbergen.
- Schnellzementestriche
- Beschleunigte Zementestriche
Anhand der Zusammensetzung des Estrichmörtels ist die Wirkungsweise grundsätzlich unterschiedlich und anders zu bewerten. Geht es um Planungssicherheit bezüglich Trocknung und verformungsfreie Aushärtung, haben ternäre Schnellzementvollbindemittel Vorteile.
Auch bei hohen Estrichdicken, z.B. in Schulen, bei unterschiedlichen Estrichdicke, z.B. Gefälleestriche in Tiefgaragen oder bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen, bedingt durch die chemische Wasserbindung, härtet der Estrich nahezu verformungsfrei aus und ist zielsicher belegreif. Noch dazu ist er sehr frühzeitig belastbar für den nachfolgenden Baustellenbetrieb.
Geht es um eine schnellere aber nicht unbedingt zielgerichtete Belegung des Zementestrichs, sind die beschleunigenden Estrichzusatzmittel gut verwendbar. Das eingesetzte Fließmittel reduziert das nötige Wasser zum Anmischen des Estrichmörtels. Je weniger Wasser in die Mischung reinkommt, desto weniger Wasser muss wieder raus.
Die Trocknungsphasen und Verformungen sind jedoch ähnlich wie bei herkömmlichen Zementestrichen.
Hohe Estrichdicken und die klimatischen Bedingungen sind ausschlaggebend für den Erfolg der Trocknung. Im Sommer, aufgrund der hohen Außenluftfeuchtewerte, wird die Trocknung erschwert.
Leider gibt es im Markt viel Unwissenheit und auch unseriöse Produktauslobungen mancher Zusatzmittellieferanten. Es werden Dinge versprochen, die größtenteils leider physikalisch nicht einhaltbar sind.
Die maßgeblichen Estrichnormen, Verbandsmitteilungen und Sachverständige warnen vor Schäden an Bodenbelägen bei abweichenden Belegreifgrenzwerten von > 1,8 CM-% beheizt und 2,0 CM-% unbeheizt.
Zudem sind die Vertragsverhältnisse im Auge zu behalten.
Zum Schluss noch ein weiteres Fallbeispiel:
Die Belegreife des Estrichs wurde nicht zielsicher erreicht, da der Estrich im Hochsommer eingebracht wurde. Die Feuchte gelangte erschwert aus dem Gebäude, die Fassade war verschlossen, der Maler und Fliesenleger waren zu Gange. Noch dazu betrug die Estrichdicke in der Schule knapp 9 cm. Die Fußbodenheizung war nicht im Betrieb.
Hier hätte ein Schnellzementestrich problemlos funktioniert. Die Kosten einer eventuell nötigen Absperrung hätten eingespart werden können und der Ärger wäre allen Beteiligten erspart geblieben.
8) Baukonstruktionen der Fußbodenheizung – vom Gebäudebestand bis zum Effizienzhaus im Jahr 2023
Referent: Prof. Dr.-Ing. Michael Günther, TGA Consulting, Dozent, Fachautor
Das Baugeschehen der Gegenwart ist sowohl von der energetischen Gebäudesanierung als auch vom Neubau moderner Wohn- und Nichtwohngebäude geprägt. Dabei reichen die Konzepte vom Effizienzhaus Denkmal 160 bis zum Effizienzhaus 40+, wobei sich die Zahlen als Über- oder Unterschreitung der GEG-Vorgaben beziehen. Hinzu kommen Merkmale wie „EE“ (erneuerbare Energien) und NH („Nachhaltigkeit“), die im Zusammenhang mit den BEG-Fördermöglichkeiten besondere Beachtung erlangen. Die gesetzlichen Leitplanken werden durch das in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz GEG gesetzt.
Die Energiekonzepte, die kurzfristig oder mittelfristig (z.B. individueller Sanierungsfahrplan iSFP mit einer Zeitspanne von 15 Jahren) realisiert werden, beinhalten auch neue Möglichkeiten des Heizens dieser Gebäude. Dabei gewinnen elektrische Systeme, von der PV-Anlage mit Batterie über die Wärmepumpe bis hin zur Direktheizung als Wärmeübergabe im Raum, an Bedeutung. Die Pflicht, bei neuen Gebäuden 65 % erneuerbare Energien einsetzen zu müssen, überträgt sich auch auf zahlreiche Vorhaben der Gebäudesanierung. Auf der Grundlage einer zwingend vorgeschriebenen kommunalen Wärmeplanung, anzuwenden auf Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohner, werden zentrale und dezentrale Systemlösungen in Abhängigkeit der Abnehmerdichte, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien das Baugeschehen bestimmen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie innerhalb der Wärmeübergabe im Raum künftige Heiztechniken aussehen sollen. Nach wie vor beinhalten im Estrich eingebettete, wasserführende Heizsysteme zahlreiche Vorteile gegenüber Konvektionsheizungen, aber auch gegenüber relativ neuen Strahlungsheizsystemen wie z.B. die Infrarotheizung. Positiv werden die thermische Behaglichkeit im gesamten Raum und die Möglichkeit des sommerlichen Kühlens wahrgenommen. Mit energetischer Bezugnahme zählen insbesondere die niedrige Vorlauftemperatur und eine ausgezeichnete Regelungsfähigkeit, insbesondere bei Systemen mit geringer Estrichüberdeckung der Heizrohre („Dünnschichtsysteme“), zu den Vorzügen. Daraus ergeben sich Energieeinsparungen, bei gleicher spezifischer Heizleistung, gegenüber Heizkörpern von bis zu 10 %. Außerdem zeigen Wirtschaftlichkeitsvergleiche einschließlich der Investitionskosten, dass die klassische Fußbodenheizung keine kostenseitigen Nachteile gegenüber Alternativen hat, wenn die gleichen Bilanzkreise berücksichtigt werden.
Im Neubau von Gebäuden kann eine massive Fußbodenkonstruktion, als thermischer Speicher, das Strom-Wärme-Management unterstützen. Die Baukonstruktion ist dann zusammen mit der Decke, als thermisch aktives Bauteilsystem (TABS) zu verstehen. Die Verbundkonstruktion ist dabei eine besondere Lösung des thermischen Ankoppelns des Fußbodens an speichernde Bauteile. Besonders in Österreich werden derartige Lösungen im Wohnungsneubau angewandt.
Im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung sind sämtliche Bauarten der Fußbodenheizung, beschrieben in DIN EN 1264 und DIN EN 11855, anwendbar. Jedoch finden Dünnschichtsysteme und auch Frästechnik-Systeme besonderen Marktzuwachs.
Vielfältige Dünnschichtsysteme weisen Konstruktionsdicken von minimal 15 mm auf und gelten (noch) als Sonderkonstruktionen, die sich jedoch seit mehr als 20 Jahren in der Praxis bewährt haben. Aber auch weitere spezielle Systemlösungen mit besonderen positiven Eigenschaften (z.B. RenoScreed® Energiespar & Sanierestrich) prägen das Geschehen bei der Modernisierung von Gebäuden.
Die ursprünglich in den Niederlanden entwickelte Frästechnik erweitert die Anwendung der Fußbodenheizung in Bestandsgebäuden. Beide vorgenannten Systemlösungen bedürfen einer objektspezifischen Planung, wobei der Ausgangszustand des Fußbodens resp. der Oberfläche auf Eignung zur Aufnahme der neuen Heizung geprüft werden muss. Hinzu kommen Anforderungen an die Rohrleitungsführung bis zum Verteiler/Sammler, sodass eine unkontrollierte und zugleich bauteilschädigende Wärmeabgabe sicher vermieden werden kann.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die traditionsreiche Vergangenheit der klassischen wasserführenden Fußbodenheizung eine sichere Grundlage für das Anwenden dieser Heiztechnik in jeglichen Gebäuden bildet. Letztendlich wertet das Heizen und Kühlen mit dem Fußboden die Bedeutung des Estrichs ebenso auf wie die Expertise der Planbeteiligten und ausführenden Handwerker.

Bild 1: Seminarraum vor Beginn des FORUMS

Bild 2: Vortragsort mit Publikum


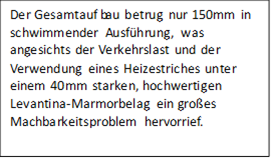













 ‚
‚