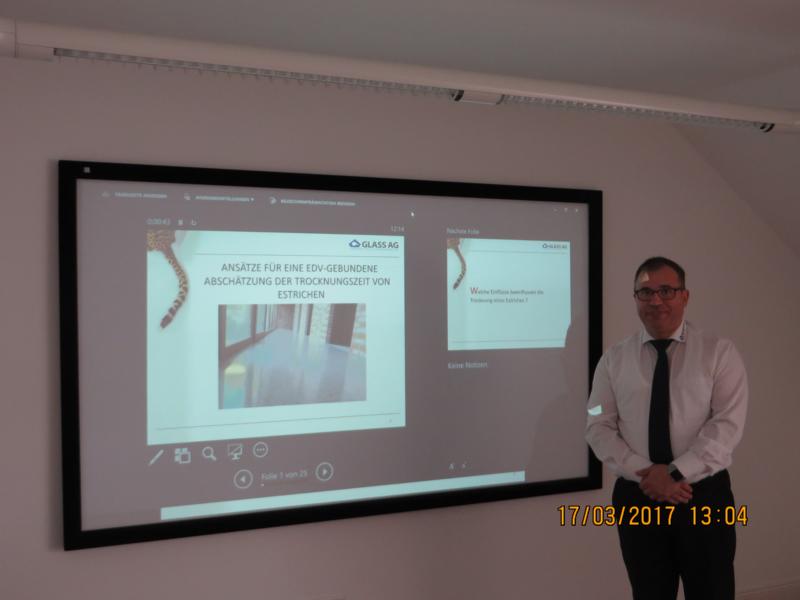Bericht verfasst von Dr. A. Unger, Donauwörth, Fachjournalist und Autor des FUSSBODEN ATLAS®
Der Beitrag beinhaltet teils wörtliche Zitate aus den einzelnen Skripten
Am 17. und 18. November 2017 fand die vom Bundesverband Estrich und Belag e.V. organisierte Veranstaltung im Mercure-Hotel in Schweinfurt statt. Wie immer war sie gut besucht und ihr Besuch empfehlenswert.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Obmann des Arbeitskreises Simon Thanner und den BEB-Vorsitzenden Michael Schlag gab es eine kurze, aber wichtige Information. Gemäß aktueller Sachlage wird es i.S. Emissionsprüfungen wohl keine Anforderungen an mineralische Estriche geben, auch wenn diesen entsprechende Zusatzmittel beigemischt werden. Dies ist ein relevantes Thema gerade auch für die Hersteller von Baustellenestrichen.
Ansonsten wurde Herr Leonhardt als langjähriger Geschäftsführer des BEB verabschiedet und ihm für seine gute Arbeit bedankt. Zudem wurden Umstrukturierungen im Bereich der Verbände (BEB/ZDB) angekündigt.
Zu den einzelnen Vorträgen:
I. Themenkomplex „Hygiene im Fußbodenbereich“
Schimmelpilzschäden – von der Probenentnahme bis zur Bewertung der Sanierungsfähigkeit
Referent: Dr.-Ing. Dipl.-Biol. Mario Blei
Der allseits bekannte Fachmann zeigte zunächst auf, dass Hygieia die griechische Göttin der Gesundheit war. Insofern verstehen wir unter dem Begriff ‚Hygiene‘ im Regelfall Maßnahmen zur Gesunderhaltung. Dr. Blei wies darauf hin, dass jedes Jahr sehr hohe Schäden durch Leitungswasserschäden entstehen, sodass es sich hier um einen wesentlichen Kostenpunkt für die Versicherungen handelt. Hier sind oft Sachverständige gefragt, festzustellen, ob neben einem aktuellen Schadensereignis auch Altschäden vorhanden sind, die z.B. Pilzwachstum oder Insektenbefall verursacht haben können. Spezialisierte Sachverständige können z.B. über Fraßgänge von Insekten abschätzen, dass der Schaden wohl etwas weiter zurück liegt, da derartige Maßnahmen länger dauern als z.B. Pilzwachstum.
Außerdem machte Herr Dr. Blei darauf aufmerksam, dass Raumluftmessungen in Innenräumen nur dann sinnvoll sind, wenn man auch eine Referenzmessung im Außenbereich vornimmt. Gerade im Herbst, bei intensivem Vorhandensein von Laub auf den Straßen, ist mit erhöhten Schimmelpilzwerten zu rechnen. Bei der Bewertung von Keimbelastungen innerhalb von Dämmungen sind auch die unterschiedlichen Dämmstoffe voneinander abzugrenzen. Hier gibt es völlig unterschiedliche Hintergrundbelastungen. Die Baustoffe Lehm und Stroh weisen z.B. immer eine relativ hohe Keimbelastung als Hintergrund auf, ohne dass sie feucht geworden wären.
In den USA wird eine Luftqualität als gut eingeordnet, wenn keine krankheitserregenden Faktoren feststellbar sind und 80% der Personen die Luftqualität als passend empfinden. Nicht selten kommt es zu Toxikopien, bei denen Patienten typische Krankheitsbilder entwickeln, obwohl die entsprechenden auslösenden Faktoren gar nicht vorhanden sind. Hier spielen häufig psychologische Komponenten eine wichtige Rolle. Ein Kunde, der davon überzeugt ist, dass seine Wohnung nicht gut für ihn ist, wird auch bei objektiv bester Luftqualität hier etwas zu beanstanden haben.
Dr. Blei wies darauf hin, dass es sich z.B. bei Legionellen, Salmonellen, etc. um Bakterien handelt, die Menschen intensiv schädigen können. Viele Pilze machen in erster Linie Probleme bei Menschen mit schlechten Abwehrsystemen, Allergikern und Asthmatikern. Sie können z.B. im ungünstigen Fall zu einer Lungenentzündung führen. Wichtig ist, zu wissen, dass es keine allgemein anerkannten gesetzlichen Grenzwerte für Schimmelpilzexpositionen gibt. Die Fachleute sind sich jedoch dahingehend einig, dass an Nichtaufenthaltsräume wie Keller und Dachböden reduzierte Anforderung an die Luftqualität nach einer Sanierung zu stellen sind. Beim Fußboden handelt es sich auch nicht um einen Wohnraum, vor allem, wenn dieser entsprechend abgekapselt wird.
Mögliche Sanierungsmethoden nach Schimmelbefall können sein: Reinigen, Desinfizieren, Abschotten und Rückbauen. Es können auch Kombinationen dieser Sanierungsmöglichkeiten sein. Wichtig ist letztendlich, immer die entsprechende Ursache zu beseitigen. Widersprüchliche Aussagen gibt es aus Sicht des Referenten von Seiten des Umweltbundesamtes. Hier sind einerseits Biozide zur Desinfektion unerwünscht, da deren Wirkung nicht nachgewiesen sei. Dr. Blei wies jedoch darauf hin, dass eine richtig durchgeführte Desinfektion die Keimanzahl in jedem Fall reduziert und insofern durchaus ein valides Mittel sein kann.
Eine Fragestellung, die in Zukunft häufiger auf die Sachverständigen zukommen wird, ist, ob ein Schimmelpilzbefall die direkte Folge eines vorliegenden Wasserschadens ist. Wenn dies nämlich nicht der Fall ist, dann könnte die Versicherung nur die Sanierung des Wasserschadens erstatten, nicht jedoch die Bekämpfung des Schimmelpilzes. Es ist davon auszugehen, dass es hierzu noch Grundsatzurteile in Zukunft geben wird.
Die häufig angetroffenen Sandwichbauweisen mit einer Vielzahl von Schichten bringen zahlreiche Probleme für eine Sanierung mit sich, da häufig hier eine Trocknung kaum möglich ist. Nochmals schwieriger wird es, wenn hier Holzbestandteile vorhanden sind.
Abschließend wies Dr. Blei darauf hin, dass sog. ‚Schimmelschnüffelhunde‘ aus seiner Sicht kein probates Mittel sind, um die Raumluft auf derartige Belastung zu untersuchen. Dies liegt daran, dass die Hunde oft falsch trainiert sind und z.B. beim Aussteigen aus dem Auto bei hohen Schimmelpilzaußenbelastungen bereits „mit einer vorbelasteten Nase“ in die entsprechenden Räumlichkeiten gehen.
I. Themenkomplex „Hygiene im Fußbodenbereich“
Flächendesinfektion in hygienerelevanten Bereichen
Referent: Dipl.-oec.-troph. Hans-Leo Fernschild
Herr Fernschild wies zunächst auf die unterschiedlichen Definitionen hin.
‚Desinfektion‘ beschreibt den Prozess, die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen und Viren durch irreversible Inaktivierung auf ein sicheres Level zu reduzieren.Von ‚Desinfektion‘ spricht man bei einer Keimreduktion um einen Faktor von mindestens 105 (dies entspricht 99,999 %) – soll heißen: von ursprünglich 100.000 vermehrungsfähigen Keimen (sogenannte ‚koloniebildende Einheiten‘ – KBE) überlebt nicht mehr als ein Einziger. Ziel: Kreuzkontamination sowie Vermehrung reduzieren/verhindern, sodass das Risiko einer Infektion reduziert wird.
Mit ‚Sterilisation, Sterilisierung und Entkeimung‘ bezeichnet man Verfahren, durch die Materialien und Gegenstände von lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z. B. Sporen) befreit werden. Den damit erreichten Zustand der Materialien und Gegenstände bezeichnet man als ‚steril‘. In der technischen Abgrenzung zur Desinfektion wird bei der Sterilisation in der Regel eine um eine Zehnerpotenz höhere Wahrscheinlichkeit der vollständigen Sterilisation gefordert. Die Sterilisation erfolgt durch physikalische (thermisch, Bestrahlung) oder chemische Verfahren.
Bei Bakterien handelt es sich um Lebewesen, die durch Zellteilung sehr schnell wachsen können. Diese kann man durch entsprechende Produkte abtöten.
Viren können sich nicht selbstständig vermehren. Da sie kein Zytoplasma und keine Ribosomen besitzen, können sie weder ihr Erbgut selbst kopieren, noch ihre Hülle selbst herstellen. Viren befallen daher fremde Zellen, die sogenannten ‚Wirtszellen‘, in die sie ihre eigene Erbinformation einschleusen.
Je nach Risikobereich, Anwendungsbereich und zu erwartender Kontamination wird die Maßnahme zur Reinigung und/oder Desinfektion bestimmt. In der Fachsprache werden 3 Arten der Desinfektion unterschieden: Routinemäßige bzw. laufende Desinfektion, gezielte Desinfektion und behördlich angeordnete Entseuchung.
Ob und wie ein Desinfektionsmittel wirkt, ist für den Anwender nicht offensichtlich zu erkennen, zumal Mikroorganismen mit dem bloßen Auge nicht wahrgenommen werden können. Aus diesem Grund haben sich Listen etabliert, in denen je nach Anwendungsbereich geprüfte Desinfektionsmittel zusammengestellt sind und dem Anwender eine Hilfestellung bei der Auswahl geben.
Die Häufigkeiten von Reinigung und Desinfektion müssen in Reinigungs- und Desinfektionsplänen festgelegt werden (auch bei Fremdvergabe, u. a. auch schon im Leistungsverzeichnis).
Reinigungsmittel bzw. Pflegemittel dürfen nur dann mit Desinfektionslösungen vermischt werden, wenn die mikrobiologische (per Gutachten) und anwendungstechnische Verträglichkeit nachgewiesen ist.
Um desinfizieren zu können, benötigt man eine glatte und abwischbare Oberfläche. Das entsprechende Substrat muss also feuchtebeständig sein und die Reinigungsflotte muss eine gewisse Zeit an der Oberfläche stehen, um die entsprechende Wirkstoffmenge ihren Dienst tun zu lassen. Eine nebelfeuchte Desinfektion ist nicht ausreichend, insofern kommen hier Beläge wie Parkett i.d.R. nicht in Frage.
In Bereichen, wo Desinfektionen notwendig sind, sind i.d.R. Dosierstationen vorhanden, da eine fertig einsetzbare Gebrauchslösung nur einen Tag verwendbar ist. Es gibt manche Desinfektionsmittel, die mit der Zeit einen Klebefilm auf dem Untergrund zurück lassen, den man mit handelsüblichen Reinigern wiederum entfernen kann. Manche Produkte enthalten Alkohole, welche bei Kontakt mit Plexiglas dazu führen, dass Letzteres trübe und brüchig werden kann. Zudem können lackierte Flächen oder Parkettversiegelungen bzw. Polymerbeschichtungen beschädigt werden. Dies ist z.B. bei Handdesinfektionsstationen häufig der Fall.
Beim Einsatz von hochalkalischen Reinigern kann es zu einem Angriff auf Linoleumbeläge kommen.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Migration von Hautdesinfektionsprodukten und Medikamenten in die Belagsoberfläche. Einige Substanzen können in Kombination mit UV-Licht dunkle Flecken nach sich ziehen. Hier ist i.d.R. dann eine Intensivreinigung und ggf. der Einsatz von bleichenden Produkten notwendig. Problematisch sind auch offene Fugen im Bodenbelag, da hier keine effektive Reinigung möglich ist.
II. Themenkomplex „Estriche/Designestriche“
10 Jahre Erfahrungen mit Designestrichen: Entwicklung/Tendenzen Neues BEB-Hinweisblatt
Referent: Dipl.-Ing. (FH) Andreas Funke
Herr Funke räumte zunächst mit der Kalkulationsanleitung einiger Estrichleger auf, welche dahin geht, für Designestriche das doppelte als bei den normalen Estrichen zu verlangen. Dies wird häufig damit begründet, dass man dann einmal aus- und wiedereinbauen kann. Diese Beträge reichen jedoch i.d.R. für eine wirkliche Sanierung nicht aus.
Werden Designestriche dem Kunden teuer verkauft, dann entstehen daraus auch entsprechend hohe Ansprüche, die der Kunde befriedigt sehen möchte. Manche Architekten verstehen unter einem Designestrich einen ‚Sichtbeton für den Boden‘, was objektiv jedoch nicht zutreffend ist. Für Sichtbeton gibt es eindeutige Klassen und Kriterien, für den Boden jedoch nicht. Auch Bezeichnungen wie ‚Fleckschutz‘ führen beim Kunden zu Missverständnissen, da er meint, dass ein solcher Boden nicht mehr verflecken wird. Dies ist natürlich nur bei entsprechender Reinigung der Fall.
In Kürze wird das BEB-Hinweisblatt über Designfußböden herausgegeben. Hier wird z.B. empfohlen, ein genaues Bausoll zu vereinbaren. Außerdem enthält es grundlegende Informationen zu Designböden sowie das Muster einer Beschaffenheitsvereinbarung. Momentan befindet sich das Hinweisblatt im Gelbdruckstadium.
Als Musterprojekte sollten dem Kunden Flächen angeboten werden, welche ca. zwei Jahre in Nutzung sind und insofern auch bereits eine gewisse Patina erhalten haben. Wichtig ist auch, darauf hinzuweisen, dass die Oberfläche von Designböden in einer gewissen optischen Bandbreite variieren kann. Unrealistischen Ansprüchen von Planern wie ‚ein R 13 in hochglanzpoliert‘ sollte man bereits am Anfang deutlich widersprechen, um keine falschen Hoffnungen zu wecken. In keinem Fall handelt es sich bei Designböden um eine billige Alternative, um sich den Bodenbelag zu ersparen. Auch auf Seiten der Designbodenverleger wird man in letzter Zeit zunehmend kreativ. Craquelierungsrisse werden dem Kunden schon mal als ‚Ice-Crack-Effect‘ verkauft. Man sollte auch über Kriterien wie ‚Wolkigkeit, abweichende Randbereiche, Applikationsspuren des Oberflächenschutzes und Porigkeit‘ sprechen.
II. Themenkomplex „Estriche/Designestriche“
Dekorative Reaktionsharzböden
Referent: Dipl.-Ing. Artur Kehrle
Der Fachmann aus dem Hause KLB wies zunächst darauf hin, dass die Auswahl eines weißen Reaktionsharzbodens häufig zu Problemen führt, da es sehr unterschiedliche Weißtöne gibt und diese durchaus verschieden wirken können. Herr Kehrle zeigte auf, dass elastifizierte Beschichtungen i.d.R. dem Kunden einen erhöhten Trittkomfort bieten. Ein wichtiges Kriterium ist die Lichtstabilität. In der Fa. KLB versteht man unter ‚Granitoptik‘ eine grobkörnige Füllung, die einen gewissen optischen Effekt mit sich bringt. Erhöhte Verschleißfestigkeiten kann man durch Einstreuungen bzw. Abstreuungen erreichen.
Der Vortragende machte auch einen Abstecher zu den Quarzkieselböden. Hier handelt es sich um offene Beläge, die gerade von der Autoindustrie gerne im Bereich ihrer Autoübergabe genutzt werden, da es hier bei laufendem Motor zu interessanten akustischen Effekten kommt.
Normale Beschichtungen sind i.d.R. aus drei Komponenten aufgebaut: Grundierung, Spachtelung und Beschichtung. Bei dekorativen Beschichtungen sind jedoch mehr Schichten notwendig, die durchaus bis zur Zahl acht gehen können. Zusätzliche Schichten können hier z. B. weitere Versiegelungen und Schliffe sein.
Den Verlegern ist zuzuraten, in erster Linie matte Versiegelungen zu verwenden, da diese kleinere Unregelmäßigkeiten im Boden kaschieren können.
Nutzer stellen i.d.R. hohe Anforderungen an industrielle Beschichtungen, auch i.S. der Gleichmäßigkeit. Bunte Beschichtungen sind dazu geeignet, Verkratzungen in einem gewissen Rahmen zu kaschieren. Wichtig ist, zu wissen, dass Beschichtungen oft nicht auf kunststoffvergüteten Spachtelungen haften, da die Vergütung häufig an die Oberfläche wandert und dadurch zu Haftungsproblemen führen kann.
Als nächstes machte Herr Kehrle einen Exkurs in die verschiedenen Untergründe, welche für die Applikation von Beschichtungen geeignet sind. Er wies darauf hin, dass Substrate i.d.R. nicht segmentiert sein dürfen und dass sich Steinholzestriche mit Holzbestandteilen i.d.R. nicht als Untergrund für Beschichtungen eignen. Gussasphaltestriche kann man mit Polyurethan beschichten, nicht jedoch mit Epoxidharzen.
Die Verwendung von Acrylatbeschichtungen sah der Referent für dekorative Böden als kritisch, da diese häufig zu schnell fest werden. Epoxidharzbeschichtungen bieten sich in erster Linie für innen an, da es im Außenbereich zu Vergilbungen kommen kann. Epoxidharze sind i.d.R. hoch vernetzt, dadurch sehr hart und chemisch beständig. Polyurethane sind weniger vernetzt, flexibler und damit auch weniger chemisch beständig.
Eine Vergilbung ist ein rein optischer Effekt und hat keine Folgen auf die technische Tauglichkeit. Auch PU-Beschichtungen verkratzen; häufig verschwinden diese Kratzer jedoch mit der Zeit zum Teil durch den sog. ‚kalten Fluss‘. Eine gute Versiegelung wird i.d.R. die Kratzresistenz verbessern. Weißbrüche sind umso sichtbarer, je dunkler der Boden ist. Schützen kann man Beschichtungen durch eine Art ‚Steinbewehrung‘ mit Hilfe von Abstreuen.
Problematisch in Richtung Fleckenbildung sind häufig Wein, Kaffee und Senf. Außerdem wird oft eine Glanzgradveränderung der Beschichtung bemängelt. Matte Beschichtungen fangen dann in Teilbereichen an, zu glänzen und glänzende Beschichtungen werden in Teilbereichen matt. Dies hat häufig mit der Nutzung zu tun. Zudem wies Herr Kehrle darauf hin, dass es wichtig ist, Beschichtungen rückstandsfrei zu reinigen und weiche Stuhlrollen zu verwenden.
III. Themenkomplex „Systemböden“
Systemböden – Grundlagen und Merkmale
Referent: Staatl. geprüfter Techniker Christian Dirnberger
Herr Dirnberger von der Fa. Lindner wies zunächst darauf hin, dass schon die Griechen und Römer Systemböden für Fußbodenheizungen hatten. Damals wurde in Hohlräumen unter dem Boden warme Luft geführt.
Zunächst unterschied der Referent die Begrifflichkeiten ‚Doppelboden‘ und ‚Hohlboden‘. Bei Doppelböden liegen die Platten lose auf und bestehen häufig aus Calciumsulfat. Hier sind Maßnahmen im Hohlraum wie Heizen, Kühlen und Lüften möglich. Außerdem gibt es auch Deckplatten aus dem Material Holz, welches üblicherweise preisgünstiger sind. Genutzt werden Doppelböden i.d.R. für hochvariable Bereiche wie Flure und EDV-Räume.
Hohlböden sind nicht so variabel wie Doppelböden und weisen i.d.R. Schalungen aus Gipsmaterial auf. Darauf werden Calciumsulfatfließestriche platziert. Diese Maßnahme findet häufig in Bürobereichen Verwendung und es sind nahezu alle Beläge einsetzbar.
Ein Trockenhohlboden ist eine spezielle Konstruktion, bei welchem die Gipsschalung mit einem Fertigteilestrich kombiniert wird. Dies ist eine sehr schnelle Lösung und es wird kaum Feuchtigkeit eingebracht. Derartige Böden sind i.d.R. bereits nach einem Tag belegreif, jedoch sind nicht alle Beläge einsetzbar.
Genormt sind derartige Konstruktionen in DIN EN 13 213. Die üblichen Angaben in der als Eurocode bekannten DIN EN 1991 in Form von Nutzlast und Flächenlast sind für auf Stützen gelagerte Systemböden eher ungeeignet. Stattdessen wird hier eine Punktlast bzw. eine Nennpunktlast angegeben. Hierzu teilt man die Bruchlast in der Prüfung durch zwei, was den entsprechenden Sicherheitsfaktor darstellt. Teilweise werden auch Einzelbemessungen am Objekt durchgeführt. Neben dem Plattenbruch ist auch eine zu hohe Durchbiegung der Platte ein Problem. Die Lasttests werden üblicherweise in Plattenmitte, an einer Plattenecke und einmal am Rand der Platte (mittig) durchgeführt. Der schwächste Lastpunkt ist für die Dimensionierung entscheidend. Bei der Fragestellung, ob Fliesen auf Systemböden verlegbar sind, ist auch insbesondere die Durchbiegung zu beachten. Nicht immer ist eine Verlegung von keramischen Belägen möglich.
Eine Trittschallverbesserung ist u.a. durch die Auswahl eines weichen Bodenbelags möglich. Es ist zu beachten, dass es durch hohe Temperaturen oder niedrige Luftfeuchtigkeiten zu einer Schüsselung von Doppelbodenplatten kommen kann.
Die Metallstützen unter dem Boden sind mit einem Korrosionsschutz ausgestattet; bei hohen Feuchten aus dem Beton kann es jedoch trotzdem zu einem korrosiven Angriff kommen.
Werden Systemfüße auf dicken Bitumenabdichtungen platziert, so können diese sich in das Abdichtungsmaterial einsinken. Dann kann es zum Klappern von Doppelbodenplatten oder Rissen im Steinbelag kommen. Hier sollten insofern besser dünne alternative Abdichtungsbahnen verwendet werden.
Ist man sich über die Belastbarkeit eines bestehenden Systembodens unsicher, so kann man Tests vor Ort durchführen, wenn eine Spreizung gegen die Decke möglich ist. Bei entsprechender Notwendigkeit können auch Verstärkungsprofile platziert werden.
Kommen bewegte Lasten zum Einsatz (z.B. Hubwagen), dann müssen diese durch einen Faktor berücksichtigt werden.
Risse und Verformungen in Systemböden entstehen fast immer im Stützenbereich, wo sich auch der Plattenstoß befindet. Hier kommt es bei entsprechender Belastung zu Plattenverformungen, die dann oft Risse nach sich ziehen. In Plattenmitte ist dies hingegen sehr selten der Fall.
III. Themenkomplex „Systemböden“
Systemböden – Grundlagen und Merkmale
Referent: Staatl. geprüfter Techniker Christian Dirnberger
Herr Dirnberger von der Fa. Lindner wies zunächst darauf hin, dass schon die Griechen und Römer Systemböden für Fußbodenheizungen hatten. Damals wurde in Hohlräumen unter dem Boden warme Luft geführt.
Zunächst unterschied der Referent die Begrifflichkeiten ‚Doppelboden‘ und ‚Hohlboden‘. Bei Doppelböden liegen die Platten lose auf der Unterkonstruktion auf und bestehen meist aus Holzwerkstoff oder Calciumsulfat. Es sind Zusatzfunktionen wie Heizen, Kühlen und Lüften möglich. Genutzt werden Doppelböden i.d.R. für hochvariable Bereiche wie Flure, Bürobereiche und EDV-Räume.
Hohlböden sind nicht so variabel wie Doppelböden und weisen i.d.R. Schalungen aus Gipsmaterial auf. Darauf werden Calciumsulfatfließestriche platziert. Diese Maßnahme findet häufig in Bürobereichen Verwendung und es sind nahezu alle Beläge einsetzbar.
Ein Trockenhohlboden ist eine spezielle Konstruktion, bei welchem die Gipsschalung und der Estrich durch untereinander verklebte Plattenelemente ersetzt wird. Dies ist eine sehr schnelle Lösung und es wird keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Baukörper eingebracht. Derartige Böden sind i.d.R. bereits nach einem Tag belegreif, die Belagseignung ist jedoch abhängig vom eingesetzten System.
Genormt sind derartige Konstruktionen in DIN EN 12 825 (Doppelböden) und
DIN EN 13 213 (Hohlböden) sowie in den für Deutschland gültigen Anwendungsrichtlinien zu den genannten Normen. Die üblichen Angaben in der als Eurocode 1 bekannten DIN EN 1991 in Form von Nutzlast und Flächenlast sind für auf Stützen gelagerte Systemböden nicht geeignet. Stattdessen wird hier eine Lastklasse bzw. eine Nennpunktlast angegeben. Hierzu wird die durch Prüfung ermittelte Bruchlast halbiert, was einem Sicherheitsfaktor von zwei entspricht. Neben dem Plattenbruch wird auch die System- bzw. Plattendurchbiegung während den Prüfungen betrachtet. Festgelegte Grenzwerte dürfen dabei nicht überschritten werden. Die Lasttests werden üblicherweise in Plattenmitte, an einer Plattenecke und Plattenrand (mittig) durchgeführt. Der schwächste Lastpunkt ist für die Dimensionierung entscheidend. Bei der Fragestellung, ob Fliesen auf Systemböden verlegbar sind, ist auch insbesondere die Durchbiegung zu beachten. Nicht auf allen Systemböden ist eine Verlegung von keramischen Belägen möglich.
Teilweise werden auch Einzelbemessungen am Objekt durchgeführt.
Eine zusätzliche Trittschallverbesserung ist u.a. durch die Auswahl eines weichen Bodenbelags, sowie schallentkoppelnde Zusatzmaßnahmen möglich.
Die Metallstützen, sowie alle anderen Bestandteile der Unterkonstruktion sind mit einem Korrosionsschutz ausgestattet; bei hohen Feuchten aus dem Beton kann es jedoch trotzdem zu einem korrosiven Angriff kommen.
Werden Systemfüße auf dicken Bitumenabdichtungen platziert, so können diese in das Abdichtungsmaterial einsinken. Bei Doppelböden führt dies zu einem Klappern der Platten, bei Hohlböden mit starren Belägen können Risse oder Belagsablösungen auftreten. Hier sollten insofern besser dünne alternative Abdichtungsbahnen, oder lastverteilende Ausgleichsestriche verwendet werden.
Ist man sich über die Belastbarkeit eines bestehenden Systembodens unsicher, so kann man Tests vor Ort durchführen, wenn eine Spreizung gegen die Decke möglich ist. Je nach vorhandenem System können belastungserhöhende Maßnahmen nachgerüstet werden. Kommen bewegte Lasten zum Einsatz (z.B. Hubwagen), dann müssen diese durch einen sog. Dynamikfaktor berücksichtigt werden.
Risse in den Oberbelägen auf Systemböden entstehen fast immer bei ungeeigneten Kombinationen aus Oberbelag und Bodensystem. Von den Herstellern für die jeweilige Belagsart freigegebene Systeme bieten hier die Sicherheit für schadensfreie Systembodenflächen.
V. Themenkomplex „Aktuelle Schadensfälle“
Messung der Oberflächenzugfestigkeit und Haftzugfestigkeit – aktuelle Untersuchungsergebnisse Neues BEB-Hinweisblatt
Referent: Dipl.-Ing. Egbert Müller
Zunächst wies Herr Müller darauf hin, dass Zementestriche zum Prüfzeitpunkt ihre Nennfestigkeit erreicht haben müssen. Dies ist lt. Merkblatt nach 28 Tagen der Fall. Bei feuchteempfindlichen Estrichen wie Calciumsulfat-, Calciumsulfatfließestrich und Magnesiaestrich ist zur Prüfung die Erreichung der Belegreife notwendig. Eine nach der Prüfungsdurchführung entstandene Ausfransung der Prüffläche darf auch bei der Überprüfung der Oberflächenzugfestigkeit nicht geschehen, weshalb derartige Prüfungen zu wiederholen sind.
Bei der Fragestellung der Genauigkeit von Handkurbelgeräten wies der Referent auf alte Untersuchungen hin, welche Ungenauigkeiten gegenüber Geräten mit elektrisch gesteuertem Kraftaufbau von 0,2 bis 0,3 N/mm2 nahe legen. Auf sehr glatten Untergründen haftet der Kleber oft nicht geeignet und es kommt zu einem Abriss in der Klebstofffuge. Bei sehr rauen Untergründen muss häufig sehr viel Klebstoff verwendet werden, was den entsprechenden Wert nach unten verfälschen kann. Dies ist insbesondere bei Acrylatklebstoffen der Fall, weshalb in solchen Fällen neuerdings der PU-Klebstoff MC Quicksolid verwendet werden kann. Hier hat man in der Zwischenzeit festgestellt, dass dieser ansonsten ähnliche Werte wie der Acrylatklebstoff zeitigt. Auf Dispersionsgrundierungen kann es zu Erhärtungsstörungen von Acrylatklebstoffen kommen.
In diesem Zusammenhang wies Herr Müller darauf hin, dass das Hinweisblatt über die Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden im Oktober 2017 neu herausgegeben wurde. Dort wurde nun auch der vorgenannte PUR-Klebstoff als Alternative zu dem Acrylatklebstoff aufgenommen. In dem Hinweisblatt gibt es auch einige gewichtige textliche Änderungen. Neu ist die Einordnung der elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Keramik- und Naturstein mit einer Mindestanforderung bei der Oberflächenzugfestigkeit von ≥ 0,8 N/mm2 und im Bürobereich von ≥ 1 N/mm2.
Für alle Beläge mit Fahrbeanspruchung und/oder im Außenbereich gilt eine notwendige Oberflächenzugfestigkeit von ≥ 1,5 N/mm2.
Bei der Oberflächenzugfestigkeit von Beton gab es in der Vergangenheit die Anforderung, dass unter Magnesiaverbundestrich ein Wert von ≥ 0,8 N/mm2 erforderlich ist. Diese Regelung existiert nicht mehr.
Bei den Haftzugfestigkeiten von Verbundestrichen gelten im Innenbereich von Gebäuden ohne thermische Beanspruchung nach Erreichen der Ausgleichsfeuchte folgende Werte:
– Ohne Fahrbeanspruchung ≥ 0,8 N/mm2
– Mit Fahrbeanspruchung ≥ 1,0 N/mm2
– Im Außenbereich und thermisch beanspruchten Innenbereichen: Mindestanforderung ≥ 1,2 N/mm2
Bei den Orientierungswerten für die erreichbare Oberflächenzugfestigkeit von Estrichen hat es keine Änderungen gegeben. Es wird lediglich ergänzt, dass zur Erreichung der Anhaltswerte/Richtwerte in vielen Fällen weitergehende Maßnahmen notwendig werden, wie z.B. zusätzliche Untergrundvorbereitungen oder Verfestigungen. Diese sind vom Planer festzulegen und gesondert zu beauftragen.
Häufig wird argumentiert, dass die Oberflächenzugfestigkeit bei Zementestrichen nicht die richtige Prüfung für einen Estrich ist. Bei Verbundestrichen ist jedoch auszusagen, dass es im Bereich von Fugen durch Verformungstendenzen genau zu dieser Belastung kommt und insofern die Prüfung durchaus relevant ist. Es ist anzumerken, dass die Haftzugfestigkeit von Estrichen am Rand durch Schwindspannungen häufig schlechter ist als in Raummitte.
‚Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden‘, Stand: Oktober 2017.
V. Themenkomplex „Aktuelle Schadensfälle“
Elektrische Messung der Holzfeuchte noch zeitgemäß?
Referent: Thomas Allmendinger
Massivparkett muss im Mittel in unseren Breitengraden mit 9 Gewichtsprozent an Feuchtigkeit geliefert und verlegt werden (Ausnahme z.B. Tropenholz). Der Wert soll elektrisch gemessen werden, im Streitfall per Darrprüfung. Bei Fertigparkett gilt ein Wert von 7 Gewichtsprozent, welcher mit der Darrprüfung ermittelt werden soll. Elektrische Messungen stellen Schätzungen dar. Nun wollte Herr Allmendinger testen, ob es überhaupt möglich ist, Fertigparkette mit einer elektrischen Messung auf ihren Feuchtigkeitsgehalt hin zu untersuchen. Bei Fertigparkett rechnet man im Bereich der Nutzschicht mit ungefähr 8 Gewichtsprozent an Feuchtegehalt, im Bereich des Gegenzugs ungefähr mit 6 Gewichtsprozent. Probleme kann es geben, wenn der Gegenzug z.B. zu trocken angeliefert wird. Während die Nutzschicht bei idealen raumklimatischen Bedingungen und einer r.F. um 50 % keine Dimensionsänderung erfährt, kommt es bei der untertrockneten Trägerschicht bereits hier zu einer Holzfeuchtezunahme aus der Raumluft und zu positiven Dimensionsänderungen. Über luftfeuchtehohe Sommermonate führt der dann deutlich stärkere Quelldruck an der Unterseite des Parketts zu sichtbaren Wellenbildungen in der diesen Bewegungen entgegenwirkenden Nutzschicht des Parketts. Wird die Tragschicht mit zu hohem Feuchtegehalt und die Nutzschicht mit ordnungsgemäßem Feuchtegehalt angeliefert, kommt es vorwiegend über die luftfeuchtearmen Wintermonate zu extremen Fugenbildungen, Verwerfungen und Rissbildungen innerhalb der Nutzschicht des Parketts.
Allgemein bekannt war, dass die Feuchtewerte der Räuchereiche wegen des Ammoniakgehaltes elektrisch nicht prüfbar sind. Die Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass der Holzfeuchtegehalt bei Mehrschichtparkett jedoch prinzipiell nicht mit elektrischen Messgeräten zuverlässig gemessen werden kann, was im Übrigen der Obmann der EN 13 489 – Mehrschichtparkett, auf schriftliche Nachfrage des Referenten bestätigt hatte. Trifft man einen Parkettfußboden an, der trotz passender Holzfeuchtigkeit eine deutliche Fugenbildung aufweist, so kann man davon ausgehen, dass vorher wohl die Feuchtigkeit noch höher gewesen sein muss.
Das Fazit des Referenten: Die zahlreichen von ihm gemessenen Fertigparkette deckten sich bei der elektrischen Messung mit Messgeräten führender Hersteller am Markt nicht mit den Darrprüfungen und es ließ sich auch kein entsprechendes Muster erkennen. Dies bedeutet für den Referenten, dass man Fertigparkett schlicht und einfach wegen der heterogenen Zusammensetzung der unterschiedlichen Schichten nicht zuverlässig elektrisch messen kann. Theoretisch könnte lediglich die Massivholzschicht orientierend gemessen werden, was der Grund für den Zusatz in der Norm darstellt. Allerdings ist dies bei Mehrschichtparkett jedoch nicht praktikabel und zuverlässig durchführbar, weshalb auch eine Prüfpflicht zur Feuchtekontrolle bei Anlieferung nicht existent sein kann. Es ist also an den Herstellern, die ordnungsgemäßen Holzfeuchtewerte für ihr geliefertes Parkett den Bodenlegern zu garantieren.
Erschreckendes Zusatzergebnis der Untersuchungen war, dass die Holzfeuchtigkeit der original verpackten und neu bestellten Ware von einem bei Schadensfällen vehement auf die Kontrollpflicht der Verleger verweisendem Hersteller, allesamt, zum Teil extrem, von den zulässigen Feuchtewerten abwichen. Lediglich die Vergleichsprobe eines anderen Herstellers, war mit dem richtigen und notwendigen Feuchtegehalt ausgeliefert worden.
VI. Themenkomplex „Technik“
Verbundabdichtungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach DIN 18534 und DIN 18531
Referent: Dipl.-Ing. Mario Sommer
Zunächst berichtete der Referent über die neue Struktur der Abdichtungsnormen.
DIN 18 531 behandelt die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dächern. DIN 18 532 befasst sich mit der Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton. DIN 18 533 behandelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, DIN 18 535 bespricht die Abdichtung von Behältern und Becken. Der wesentliche Vortragsbestandteil war die DIN 18 534, welche die Abdichtung von Innenräumen behandelt.
Es ist zu beachten, dass die neue Abdichtungsnorm bereits im Juli 2017 in Kraft getreten ist. Zunächst berichtete der Referent über die verschiedenen Materialien, mit denen die Abdichtungen in Zukunft hergestellt werden können. Bei flüssigen Materialien geht es insbesondere auch um die Erreichung der geeigneten Mindesttrockenschichtdicken. Im Anschluss ging es um bahnenförmige Fliesenverbundabdichtungen, deren Dichtigkeit häufig durch die Platte selbst erreicht wird. Flüssig aufzubringenden Abdichtungsstoffe im Verbund müssen in Innenräumen eine Wassersäule von 10 cm aushalten. Wichtig ist hier, dass grundsätzlich alle Systemkomponenten des Herstellers, wie z.B. Klebebänder verwendet werden.
Neu in DIN 18 534-1 ist die Einteilung nach den verschiedenen Wassereinwirkungsklassen: W 0-I betrifft geringe Wassereinwirkung, W 1-I mäßige, W 2-I hohe und W 3-I sehr hohe. Hier sind entsprechende Anwendungsbeispiele zugeordnet. Befindet man sich in Grenzbereichen kann es sinnvoll sein, diese der jeweils höheren Wassereinwirkungsklasse zuzuordnen. Ein wirksamer Spritzwasserschutz kann z.B. in Duschen i.d.R. nicht durch Vorhänge erreicht werden. Hier sind wahrscheinlich eher Glastüren, Abtrennungen oder Ähnliches vonnöten.
Bodengleiche Duschen werden der Wassereinwirkungsklasse W 2-I zugeordnet. Bei barrierefreier Bauweise ist immer auch zu beachten, dass in diesem Bereich dann auch das Wasser keine Barrieren hat und sich entsprechend ausbreiten kann. Ein häusliches Bad mit einem Ablauf soll nun auch der Wassereinwirkungsklasse W 1-I zugeordnet werden.
Schwimmbadbereiche und auch Großküchen kommen in die Klasse W 3-I. Schwimmbäder selbst werden wiederum von der DIN 18 535 ‚Behältnisse‘ geregelt. In Großküchen müssen Abdichtungen nicht nur chemisch beständig, sondern auch mechanisch belastbar sein (z.B. bei der Nutzung mit Hubwägen). Balkone und Terrassen werden in Zukunft in der DIN 18 531 ‚Dächer‘ geregelt. Bei der Verwendung von Verbundabdichtungen in Verbindung mit Fliesen und Platten sollten Letztere möglichst weitgehend vollflächig gebettet sein. Besser ist eine Verlegung auf Kreuzfuge. Die Mörtelstege unter den Fliesen sollten möglichst parallel ausgerichtet sein, um eine optimale Bettung zu erzielen.
Bei den Wassereinwirkungsklassen W 2-I und W 3-I müssen immer Abdichtungen verwendet werden. Bei Wassereinwirkungsklasse W 0-I ist eine wasserabweisende Oberfläche ausreichend. Ansonsten müssen auch hier Abdichtungen eingesetzt werden.
Abdichtungen müssen immer 20 cm über die höchste Wasserentnahmestelle hochgezogen werden. Auch Zementestriche müssen gemäß der entsprechenden Wassereinwirkungsklasse abgedichtet werden, da körperliches Wasser den Estrich durchdringen und auf die Dämmung laufen kann. Am Rand soll die Abdichtung mindestens 5 cm hochgeführt werden. Anstatt im gleichen Raum mit zwei verschiedenen Abdichtungsarten zu arbeiten, sollte man im Zweifelsfall die bessere Abdichtungsklasse durchziehen. Bei Wassereinwirkungsklasse W 0-I und Wassereinwirkungsklasse W 1-I können feuchtigkeitsempfindliche Baustoffe verwendet werden, bei höheren Einwirkungsklassen nicht.
Es ist zu beachten, dass wasserführende Ebenen Gefälle benötigen, außer das Wasser wird anders entfernt. Dies kann z.B. durch Wasserschieber erfolgen, wie dies häufig bei Großküchen der Fall ist, wo man ‚Berg- und Talbahnen‘ nicht wünscht. Für Durchdringungen sollten grundsätzlich die passenden Manschetten zum Einsatz kommen. Kleb- und Pressflansche müssen mindestens eine Breite von ≥ 5 cm aufweisen. Bei Flanschbreiten um die 3 cm ist die Verwendung von Spezialmaterialen wie z.B. Reaktionsharzen notwendig.
Es ist zu beachten, dass auf Polyethylen i.d.R. kaum ein Material hält. Hier sollte unter diesem Aspekt ein anderes Material, wie z.B. Edelstahl zum Einsatz kommen. Bei zwei Abdichtungsebenen muss jede extra entwässert werden. In der Vergangenheit kam es hier häufig zu einem Rückstau in der unteren Ebene und damit zu einer Überflutung dieses Bereiches. Hier erging die Empfehlung, in Zukunft die untere Ebene als Sicherheitsebene zu betrachten. Die Abdichtung wird dort verlegt, aber diese Ebene nicht an den Gully angeschlossen. Es ist insofern in der unteren Ebene kein Ablaufen in den Gully möglich, da das Rohr weiter nach oben geführt wird. Damit ist ein Rückstau in dieser Ebene nicht möglich. Lediglich die obere Abdichtung wird an den Gully angeschlossen.
Unter Bade- und Duschwannen dürfen sich nur noch z.B. die zur Entwässerung notwendigen Rohre befinden, um die Abdichtung zu erleichtern. Elastische Fugenbereiche sollte man sicherheitshalber mit Schnittschutzbändern ausrüsten, sodass bei einer Erneuerung hier keine Abdichtungsmaterialien durchgeschnitten werden. Auch in barrierefreien Bädern sollte ein kleines Wasserhindernis Verwendung finden. Bei der Wassereinwirkungsklasse W 3-I ist z.B. sogar eine Rinne zur Trennung vonnöten. Auf Rückfrage sagte der Referent, dass in W 3-I Bereichen bei aufgeständerten Böden keine feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie z.B. Calciumsulfat für Trägerplatten zum Einsatz kommen. Bei Wannen sollte man entweder seitlich andichten oder aber unter der Wanne.
VI. Themenkomplex „Technik“
Wirkungsweise von Grundierungen unter Spachtelmassen, Klebstoffen
Referent: Dr. Dipl.-Chem.-Ing. Jörg Sieksmeier
Das abschließende Thema“ wurde durch den sehr detaillierten und anwendungsbezogenen Vortrag von Dr. Jörg Sieksmeier (Leiter Forschung und Entwicklung der ARDEX GmbH) präsentiert. Kernpunkte waren die Wirkungen und chemischen Unterschiede von Grundierungen und hier insbesondere die Wasserdampfdiffusionsbremsen. Werden Untergründe gegen Restfeuchtigkeit abgesperrt, so wies der Referent darauf hin, dass häufig der erreichte Sperrwert solcher Produkte bei maximal 70 m sd liegt. Insofern funktionieren derartige Systeme gut, wenn z.B. ein weniger sperrender Kautschukbelag mit 40 m sd darauf zum Liegen kommt. Wenn manchmal Absperrprodukte mit niedrigeren sd-Werten als der Bodenbelag trotzdem funktionieren, dann liegt es oft daran, dass nicht nur ein Film an der Oberseite entsteht, sondern auch die Kapillaren des Estrichs bis zu einer gewissen Tiefe verstopft werden.
Zunächst fragte der Vortragende das Publikum, für welchen Zweck Grundierungen eingesetzt werden. Es kamen Argumente wie Staubbindung, Homogenisierung der Saugfähigkeit, Vermeiden des Verdurstens der Spachtelmasse, Verwendung als Haftbrücke zu schwierigen Untergründen wie Keramik, als Absperrung gegenüber Untergrundfeuchtigkeit und zur Untergrundverbesserung.
Dr. Sieksmeier wies darauf hin, dass auf saugfähigen mineralischen Untergründen häufig wässrige, alkalistabile Styrol-/Acrylatdispersionen eingesetzt werden. Auf nicht saugfähigen mineralischen Untergründen, wie z.B. Fliesen kommen häufig wässrige Spezialgrundierungen in hoher Konzentration oder reaktive Systeme zur Verwendung. Auf nicht saugfähigen und nicht mineralischen Untergründen wie z.B. Gussasphalt verwendet man Spezialgrundierungen oder reaktive Systeme. Auf sonstigen Untergründen wie z.B. feuchten Estrichen kommen reaktive Systeme zum Einsatz.
Bei einkomponentigen PU-Grundierungen zeigte der Referent auf , dass es sich im Grunde auch hier um 2K-Produkte handelt. Die zweite Komponente ist die Luftfeuchtigkeit oder die Feuchte aus dem Untergrund, durch welche es zur Erhärtung kommt. 1K-PU-Produkte sind nicht wässrige Komponenten. Bei Dispersionsgrundierungen ist eine Mindesttemperatur für die Verfilmung notwendig. Ist diese unterschritten, so wird die Dispersion schnell pulverförmig und funktioniert nicht. 1K-PU funktioniert nur, wenn auch tatsächlich eine ausreichende Luftfeuchtigkeit bzw. Untergrundfeuchtigkeit zur Verfügung steht. Bei 2K-PU-Produkten kommt ein Härter zum Einsatz. Hier ist wichtig, dass genau die richtige Härtemenge verwendet wird, da sowohl ein zu viel wie auch ein zu wenig zu Problemen führen kann.
Unerlässlich für eine mangelfreie Ausführung ist lt. Dr. Sieksmeier die Verwendung von Spachtelmassen, da die Saugfähigkeit und Ebenheitsanforderungen von Estrichen oft für eine mangelfreie Ausführung nicht ausreichend sind. Im System mit Grundierungen und Klebstoffen wies Dr. Sieksmeier insbesondere auf die Notwendigkeit von emissionskontrollierten Verlegewerkstoffen hin. Systemprodukte, die nach der GEV-Methode gemessen werden, erfüllen aus seiner Sicht höchste Ansprüche bezüglich der VOC- Minimierung (VOC = volatile organic compounds; flüchtige organische Bestandteile). Durch einen ‚Selbsttest‘ mit 10 Sachverständigen demonstrierte der Referent auch den ‚Sinn oder Unsinn‘ sogenannter Geruchsprüfungen in anschaulicher Weise.
Dr. Sieksmeier wies darauf hin, dass bei nachstoßender Feuchtigkeit keine Gipsspachtelmassen zum Einsatz kommen sollten. Zudem beinhalteten die heute verwendeten Spachtelmassensysteme immer weniger Portlandzement. Probleme kann es geben, wenn Weichmacher aus einem Klebstoff (z.B. Silan) in die Spachtelmasse penetrieren. Ist diese dann nicht ausreichend dick, dann kann es Reaktionen zwischen der Grundierung und den Weichmachern aus den Klebern geben, die das Gesamtsystem stören können.

Bild Vortragssaal mit Publikum